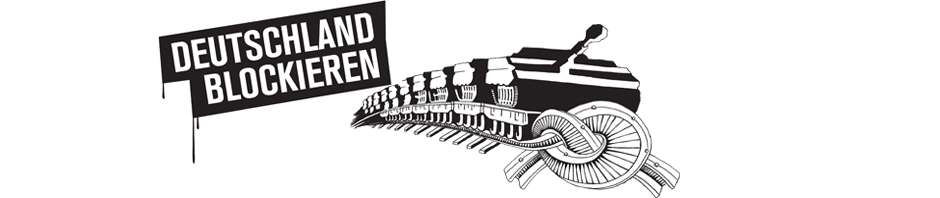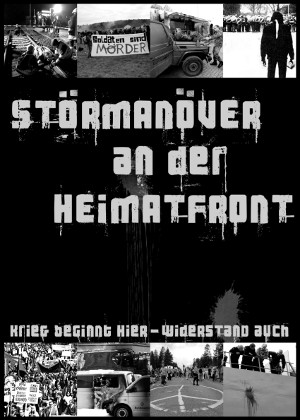Am 17.2. findet am Landgericht Flensburg ein Zivilverfahren gegen die Antimilitaristin Hanna Poddig statt. Wegen ihrer Beteiligung an einer Protestaktion gegen die Bundeswehr im Februar 2008 fordert die Bahn 14.000 Euro von ihr. Ein Militärtransport der Bundeswehr verzögerte sich damals um 243 Minuten. Das soll nun nicht ungestraft bleiben. Die Chancen für ein faires Verfahren für die Aktivistin stehen schlecht. Zu deutlich ist der enge Zusammenhang zwischen Armee und Justiz und ihrer Funktion bei der Durchsetzung von Herrschaft im Landgericht Flensburg sichtbar, als dass die Illusion von unabhängigen Gerichten überhaupt erst entstünde.
Prozesse gegen Antimilitaristin am Flensburger Gericht
Am Mittwoch, den 17.2. um 14:00 findet im Landgericht Flensburg ein Zivilprozess gegen die Antimilitaristin Hanna Poddig statt. Die Bahn behauptet, dass eine Reparatur am Gleis im Wert von 14.000 Euro notwendig gewesen und von der Aktivistin verursacht worden sei. Frau Poddigs Anwalt zieht diese Darstellung in Zweifel. Die Angeklagte freut sich über Unterstützung aller Art. So fand in den letzten Tagen Straßentheater und Flugblattverteilen statt. Außerdem organisierten Unterstützerinnen und die Angeklagte eine Lesung im Infoladen Subtilus. Dass AntimilitaristInnen nichts Gutes am Landgericht zu erwarten haben, zeigte Richter Weis bereits in der Vorphase des Prozesses. So lehnte dieser einen im Zivilverfahren üblichen Antrag auf Prozesskostenhilfe ab, da seiner Meinung nach für die Angeklagte keine Aussicht auf Erfolg bestünde. Dieser die Obrigkeit schützenden Geist, der gegen Oppositionelle wie Hanna massiv vorgeht, hat im Flensburger Gericht ein lange Tradition.
Der Blick schweift über das Treppenhaus des Amtsgericht. Hinter der Pickelhaube prangt der Reichsadler. In Uniform und überlebensgroß steht Wilhelm der II. im Altbau des Amtsgerichtes. Er befindet sich in guter Gesellschaft. In den Stockwerken unter ihm wird den am Vernichtungskrieg von 1939-45 beteiligten Justizangestellten und Anwälten aus Flensburg gedacht, die ihre Verstrickungen in die nationalsozialistischen Verbrechen mit dem Leben bezahlten. Ein Stockwerk tiefer hängen auch die Gedenkplatten für die beim gescheiterten imperialistischen Welteroberungsversuch von 1914-1918 gestorbenen Justizangestellten und Anwälte aus Flensburg.
Selbstverständlich fehlen an all diesen Symbolen jegliche Kommentierungen oder kritische zeithistorische Hinweise. Dabei zeigen diese deutlich den untrennbaren Zusammenhang von Justiz, Militär und Nation als Durchsetzungsmittel von Herrschaft.
Durchsetzung der preußischen Herrschaft durch die Justiz
Dass Flensburg zu Deutschland definiert wird, ist noch nicht sehr lange „selbstverständlich“. Das heutige Bundesland Schleswig-Holstein (außer Herzogtum Lauenburg, dafür mit Altona und Wandsbek) standen bis 1864 unter der Souveränität der dänischen Krone. Dies ändert sich damit auch für Flensburg erst 1864 nach dem deutsch-dänischen Krieg, in dem Preußen die Herrschaft über den Landesteil Schleswig (und damit auch Flensburg) erobert. Sofort setzt eine rege Bautätigkeit ein. Fast alle Amtsgerichte in Schleswig-Holstein stammen aus dieser Zeit. Zur Durchdringung der von einer starken dänischen und friesischen Minderheit bewohnten Grenzprovinz war die Etablierung einer national-preußischen Justiz, die die Interessen der herrschenden preußischen Eliten durchsetzte, unerlässlich.
Der angebliche Reichsgründer Wilhelm in Uniform.
In diesem Kontext ist auch das Flensburger Gericht zu sehen. Als Ausdruck, wessen Gerechtigkeit hier herrscht, findet sich die uniformierte Figur mit der preußischen Pickelhaube unter dem Dach des Amtsgerichtes. Wie alle Symbole dient diese Figur als Inszenierung dessen, was gesellschaftlich als „gut“ und „wünschenswert“ dargestellt werden soll. Völlig offen tritt mit der Uniform und der Pickelhaube zu Tage, dass jene bis heute vielfach als positiv empfundene „Reichsgründung“ mit Feuer und Schwert durch uniformierte staatlich bezahlte Gewalttäter im angeblich friedenschaffenden Auslandseinsatz mit vielen Toten herbeigeschossen wurde. Selbstverständlich geschah dies gegen den Willen vieler Betroffenen. Den Unmut dieser zu unterdrücken war unter anderem auch die Aufgabe der Justiz in Flensburg. So war z.B. das Verwenden der dänischen Fahne bis in die Zeit der Weimarer Republik verboten. Den damit verbundenen Herrschaftsanspruch setzten u.a. die im imperialistischen Welteroberungsversuch von 1914-18 gestorbenen Justiziare durch. Die als historisch inszenierte Zurschaustellung alter Reichsgründungssymbole thematisiert nicht, dass eben diese nur durch Militarismus, Krieg und eine gegen Oppositionelle vorgehende Justiz möglich war.
Keine Kritik an 1939-45?
Auch die Gedenktafel für die von 1939-45 gestorbenen Hitler-Helfer ist entlarvend. Es gibt weder eine kritische Einordnung, noch wird irgendwo den in der NS-Zeit verurteilten Personen gedacht. Dies ist kein Wunder. Kein Richter aus der Nazizeit wurde für seine Urteile und die damit einhergehende Unterstützung der Herrschaft der Nationalsozialisten in späteren Jahren belangt. Im Gegenteil: Die Richter, die in Flensburg zur Durchsetzung des nationalsozialistischen Herrschaftsanspruchs Menschen in vielen Fällen zu schlimmen Strafen verurteilten, konnten nach 1945 unbehelligt weiter in der Urteilsfabrik „Gericht“ ihr Unwesen treiben. Mit Ausnahme natürlich derer, deren Namen bis heute auf den Gedenktafeln stehen.
Foltererschutz durch die Staatsanwaltschaft auch im demokratischen Regime
Auch heute weht noch durch die Hallen am Südergraben ein unsäglich autoritärer Geist zur Durchsetzung des Herrschaftsanspruches des demokratischen Regimes. Dies beweist das Beispiel des dort für politische Strafsachen tätigen Staatsanwaltes Joachim Berns. Dieser stellte beispielsweise 2002 ein Verfahren gegen zwei Westerländer Polizisten ein. SEK-Beamte aus Eutin hatten diese angezeigt, weil sie gesehen hatten, wie die beiden nordfriesischen Polizisten Verdächtige u.a. getreten hatten, um Aussagen zu erpressen. Berns stellte trotz Geständnissen das Verfahren wegen „geringer Schuld“ gegen eine Spende von 500 Euro ein. Dass Berns nicht nur einfach ein Gutmensch ist, sondern ein politisch motiviert handelnder Uniform-und Elitenschützer ist, zeigt sich an einem anderen Beispiel. 2008 stoppte eine kleine Gruppe von Aktivist_innen in der Nähe von Husum einen Materialtransport der deutschen Militärs für die Nato-Response-Force, um gegen die Bundeswehr zu protestieren. Der Anwalt der Aktivistin Hanna Poddig schrieb daraufhin an Staatsanwaltschaft und Gericht, ob es in Anbetracht der bisherigen Unbescholtenheit und der prekären finanziellen Lage seiner Mandantin nicht möglich sei, das Verfahren einzustellen. In Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei der Aktion nicht um ein Verbrechen im eigentlichen Sinnen, sondern um eine Demonstration gehandelt habe, sei es angebracht, die Geschichte mit „Einstellung wegen geringer Schuld“ und 500 Euro Spende aus der Welt zu schaffen.
Die Stellungnahme von Staatsanwalt Berns zu den Ausführungen des Anwaltes ist entlarvend: In keiner Weise sei von geringer Schuld zu sprechen, da für die Aktion enorme „kriminelle Energie“ notwendig gewesen sei. Es zeigt sich sehr deutlich: Willhelms obrigkeitshöriger Geist schützt bis heute die Uniformierten vor Kritik, während die Kritiker bestraft werden sollen. Dabei ist Staatsanwalt Berns leider kein Einzelfall. Staatsanwaltschaften schaffen es regelmäßig, Strafverfahren gegen PolizistInnen und andere Elitenangehörige geräuschlos aus der Welt zu schaffen. Uniformierte können sich darauf verlassen, dass ihnen vor Gericht mehr geglaubt wird, als anderen Menschen. Deshalb z.B. funktioniert der Widerstandsparagraph so gut: Es kommt regelmäßig vor, dass PolizistInnen illegal Leute verprügeln (nicht das dies besser wäre, wenn dies legal geschieht). Wehren sich die Opfer der uniformierten Gewalttäter nun mit Anzeigen, behaupten die Cops einfach, die Opfer hätten angefangen… Staatsanwaltschafen verfolgen nun regelmäßig die Opfer der Gewalt, anstatt gegegn die TäterInnen vorzugehen.